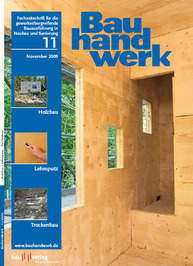Traditionell?
Gestaltungsmöglichkeiten im Innenausbau mit Lehmprodukten
Bereits seit einigen Jahren ist in Deutschland eine Renaissance der Lehmputze zu vermelden: Das gilt nicht nur für Denkmäler und Bestandsbauten, sondern auch für den Innenausbau privater und gewerblicher Neubauten. Der folgende Beitrag informiert über die Möglichkeiten moderner Oberflächengestaltung mit dem traditionellen Baustoff Lehm.
Lehm ist weltweit der älteste Baustoff: Bereits im Alten Testament wird über Lehm und Lehmziegel berichtet. In verschiedenen Erdteilen wird er heute noch wie im Altertum genutzt. Lehm gibt es überall reichlich, meist sogar direkt am Bauort. Lehmbauprodukte lassen sich zudem mit geringem Energieeinsatz (der Energieeinsatz beschränkt sich auf Anmischung und Transport) und ohne schädliche chemische Umwandlungsprozesse herstellen. In Deutschland gibt es momentan etwa zwei Millionen Gebäude, an denen Lehmbaustoffe verarbeitet wurden.
Der Baustoff Lehm
Lehm ist ein variables Gemisch mit den Hauptbestandteilen Ton, Sand und Schluff. Je nach Höhe des Tonanteils am Gemisch wird er als fett oder mager bezeichnet. Für rissfreie starkwandige Arbeiten muss fetter Lehm mit ausreichend Sand „abgemagert“ werden. Die Eigenschaften des Baustoffs Lehm schaffen einen hohen Wohnwert: Er reguliert die Raumluftfeuchte, weil er dreißigmal mehr Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnimmt als gebrannte Ziegel. Durch die langsame Abgabe der Feuchtigkeit wird die relative Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen reguliert.
Bei der Verarbeitung können Unebenheiten an bestehenden Wandflächen angepasst, aber auch plastische Formen gestaltet werden. Die Fähigkeit zum kapillaren Wassertransport schützt und konserviert Holzkonstruktionen. Die so geschaffene niedrige Holzfeuchte von nur 8 bis 12 Prozent eignet sich nämlich nicht als Lebensraum für tierische Schädlinge und Pilze, die dafür mindestens 20 Prozent benötigen.
Darüber hinaus werden auch Gerüche schnell absorbiert, weshalb die Luft im Raum immer frisch und angenehm ist. Kondenswasser in Bad und Küche wird sofort aufgenommen – kleine Nebenwirkung: Der Spiegel im Bad beschlägt nicht mehr. Es gibt allerdings auch Grenzen: Für Spritzwasserbereiche ist Lehm ohne zusätzlichen Schutz nicht geeignet.
Bauen mit Lehm
Die Stampflehmwände des Altertums sind die Urform aller heute praktizierten Einschalungstechniken am Bau. Verschiedene farbige Lehme mit Stein-, Kies- und Sandzusätzen werden dabei lagenweise in eine stabile Einschalung gestampft. Optisch erinnern solche Wände an natürlich gewachsene Böden. Für raumhohe Stampflehmwände verlangt der Statiker heute jedoch Wanddicken um 60 cm, bei Raumteilern ohne Belastung sind geringere Querschnitte möglich.
Lehm wird weiterhin zu luftgetrockneten und gebrannten Ziegeln verarbeitet. Die Steinfestigkeiten liegen hier bei
2 bis 4 N/mm2 und befinden sich damit zwar an der Untergrenze für gebranntes Material nach DIN 1053, was für viele Bauaufgaben jedoch völlig ausreichend ist. Mauerwerk aus Lehmsteinen wird überwiegend für nicht tragende Innenwände eingesetzt.
Für den Lehmbau ist heute eine große Palette von Baustoffen in konstanter Qualität lieferbar. Das sind neben Stampflehm und Lehmsteinen auch Schüttungen, Putzmörtel sowie grobe und feine Lehmputze. Die schilfarmierten Lehmbau- und Trockenbauplatten erleichtern den Innenausbau. Effektvolle Oberflächen können mit weißen oder farbigen Lehmstruktur- und Streichputzen sowie Lehmfarben gestaltet werden. Zur erforderlichen Armierung und für Bauteilfugen werden Jutegewebe in verschiedenen Breiten angeboten. Für die Ausführung bietet beispielsweise der Hersteller Claytec eine große Auswahl an Spezialkellen aus Japan an. Dort haben Lehmputze übrigens seit jeher einen sehr hohen Stellenwert in der Wohnkultur.
Natürliche Zusatzstoffe
Zusätze erhält jedes Lehmprodukt zweckgebunden. Neben Sand in verschiedenen Körnungen sind das bei Stampflehm farbige Steine und Kiesel. Lehmsteine und Lehmmörtel enthalten ebenfalls hohe Sandanteile. Bei Schüttungen sind es meist Strohhäcksel und natürliches Dämmmaterial. Zur Herstellung von Plattenware ist hingegen eine Armierung erforderlich. Das kann Schilf, Flachs oder Stroh sein. In manchen Regionen wird dafür auch Ginster, Heidekraut oder ähnliches verwendet. Historischen Putzen wurden seinerzeit oft auch Rinderhaare zugegeben.
Moderne Lehmedelputze enthalten für die optische Wirkung der Oberfläche ebenfalls eine Vielzahl natürlicher Zusätze: 5 mm Strohhäcksel beispielsweise, an der Oberfläche herausgewaschen, ist bei dunkelfarbigen Putzen wegen des Goldeffektes beliebt. Natürliche farbige und weiße Mineralien wie Tonerde ermöglichen neben Naturweiß eine bisher nicht gekannte Farbigkeit. Aber auch Zusätze von Pflanzenteilen, Marmorbruch, Ziegelsplitt oder Glasbruch ergeben eine unverwechselbare Oberfläche. Für eine bessere Verarbeitung und Abbindung setzen die Hersteller auch – in kleinen Mengen – natürlichen Zelluloseleim und Pflanzenstärke zu.
Verarbeitung von Lehm
Lehmputz
Lehmputztechniken mit modernen Lehmprodukten können sowohl in herkömmlicher Handwerkstechnik als auch mit modernen Putzmaschinen ausgeführt werden. Durch die jederzeit mögliche Lösbarkeit mit Wasser gibt es bei der maschinellen Verarbeitung auch keine Probleme bei der Reinigung. Geliefert werden kann Lehm in Kleingebinden, als Sackware oder in bis zu 800 kg schweren „Big-Bags“.
Die hohe Wohnqualität von Lehmputz ist nur durch eine ausreichende Putzschichtdicke zu erreichen. Nach Aufbringen auf altem Mauerwerk muss der Handwerker den Unterputz mit einem Aluminium-Richtscheit scharf abziehen. Kritische Untergründe sollten ganzflächig und überlappend mit einer eingelegten Armierung aus Jute- oder Glasgewebe versehen werden. Das gilt auch für die Fugen bei versetzt montierten Lehmbauplatten. Nach dem Glätten mit einem Schwammbrett muss die Oberfläche der Unterputze zur besseren Verbindung mit der folgenden Schicht mit einer Zahnkelle aufgeraut werden. Wie bei der Verarbeitung von Kalkputz erfolgt der Auftrag des groben Oberputzes mit einem Edelstahlglätter, während das anschließende Abreiben mit dem Schwammbrett ausgeführt wird. Die Schichtdicke des Oberputzes sollte etwa 1 cm betragen. Der folgende feine Lehmober- oder Lehm-edelputz wird hingegen nur etwa 3 mm dick aufgebracht und abschließend mit einem feinen Schwammbrett ge-glättet.
Effektputze aus Lehm
Lehmeffektputze werden in vielen Variationen angeboten. Die weit verbreitete Meinung, das Lehm braungelb und ausschließlich ein Material für die Denkmalpflege ist, hat sich längst überholt. Farbige Lehm- und Lehmstrukturputze sowie auch Lehmfarben sind für fast alle Untergründe geeignet. Sie ergänzen und unterstreichen andere natürliche Bauteile zudem durch ihre unverwechselbare Optik.
Die Farbigkeit wird durch verschiedene natürliche Mineralien erreicht. Zusätze sind nicht nur zur Abmagerung, sondern auch für die Gefügestabilität und Elastizität erforderlich. Gleichzeitig werden damit bisher unbekannte Oberflächeneffekte erzielt.
Bei Strukturputzen müssen nach dem Antrocknen die verschiedenen Zuschläge mit einem feuchten Schwammbrett und einer Abstreifwanne, wie beim Fliesenleger, freigelegt werden. Dafür ist eine Mindestputzhöhe von 3 mm erforderlich. Die Flächen von Lehmstreichputz sind viel lebhafter als glatte Lehmfarbenanstriche. Der Auftrag mit der klassischen Malerstreichbürste ergibt hier die besten Ergebnisse.
Auf die genannten Putzsysteme abgestimmt sind Sicherheitsgrundierungen, basierend auf natürlichem Kasein oder Silikat, lieferbar. Es werden auch Lehmputz-Beschichtungen aus Wachs, Öl, Kunststoffdispersionen oder deren Kombinationen angeboten. Diese Produkte mögen zwar die Lehmoberfläche festigen, können aber nach Einschätzung des Autors viele der zuvor aufgezählten Vorteile des Lehms aufheben.
Lehmbauplatten
Mit Lehmbauplatten arbeitet der Handwerker wie mit herkömmlichen Gipskartonplatten. Solche Platten können im Altbau, aber auch als Schalung zum dichten Auffüllen von Hohlräumen mit Leichtlehm dienen. Bei den Herstellern oder beim Dachverband Lehm können ausführliche Merkblätter für das gesamte Lehmbauprogramm angefordert werden.
Fazit
Für das Handwerk eröffnen sich durch den Baustoff Lehm neue Perspektiven. Auch in der modernen Architektur bieten sich viele Gestaltungsmöglichkeiten in Verbindung mit anderen historischen und modernen Baustoffen an. Die natürlichen Oberflächenstrukturen und vielfältigen Erdfarben der Lehm-Edelputze werden daher immer häufiger auch gezielt zur Gestaltung von Neubauten ausgewählt. Neben den gestalterischen Möglichkeiten hat Lehm auch bei der Verarbeitung viele Vorteile: So kann das Material übers Wochenende auch mal in der Putzmaschine oder im Schlauch verbleiben, was der Putzer gewiss zu schätzen weiß.↓