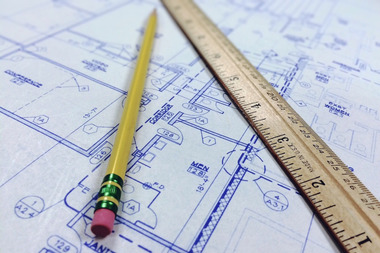Nachfolge im Handwerk: Welche Betriebe beim Verkauf besonders gefragt sind
Auf die deutschen Handwerksbetriebe rollt eine riesige Nachfolgewelle zu. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) schätzt, dass bis 2030 rund 125000 Inhaber in den Ruhestand gehen. Damit steht fast ein Viertel aller Betriebe vor einem Generationenwechsel. Für die Branche liegt darin eine große Herausforderung, hat doch bislang nur ein Teil der abgabewilligen Inhaber eine Nachfolgelösung gefunden.
Dabei kommt ein Verkauf in der Regel nur für die etwa 20 Prozent der Betriebe, die einem Jahresumsatz von mindestens zwei Millionen Euro aufweisen, infrage. Zusammengenommen erwirtschaften diese aber mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes im Handwerk. Und sie stellen den Großteil der übergabefähigen Strukturen – vor allem dort, wo Organisation, Kundenbeziehungen und Prozesse nicht allein auf den Inhaber zugeschnitten sind.
 Insbesondere das Handwerk ist vom demografischen Wandel betroffen. Doch sind nicht alle Betriebe an externe Käufer vermittelbar. Entscheidend für eine erfolgreiche Nachfolge ist weniger die Größe des Betriebs als vielmehr dessen Struktur
Insbesondere das Handwerk ist vom demografischen Wandel betroffen. Doch sind nicht alle Betriebe an externe Käufer vermittelbar. Entscheidend für eine erfolgreiche Nachfolge ist weniger die Größe des Betriebs als vielmehr dessen Struktur
Foto: Michaela Podschun
Drei Fallstricke bei der Nachfolge
Dabei ist die Betriebsgröße allein kein entscheidendes Kriterium für die Übergabefähigkeit. Wichtig ist vor allem, dass das Unternehmen innerlich stark ist. Um das zu erreichen, sollten übergabewillige Inhaber die folgenden Fallstricke umgehen.
Fallstrick 1: Abhängigkeit vom Inhaber
Viele Betriebe leben von der Person und dem Namen des Inhabers, der über viele Jahre die Kundenbeziehungen gepflegt und interne Abläufe entscheidend geprägt hat. Geht diese Schlüsselperson von Bord, sinkt die Übertragbarkeit des Betriebs drastisch. Wichtig ist deshalb, eine zweite Führungsebene einzuziehen und Prozesse so zu dokumentieren, dass Außenstehende leicht das Ruder übernehmen können. Denn kein Nachfolger übernimmt gerne ein Unternehmen, dessen Erfolg allein an einer Person hängt.
Fallstrick 2: Mangelhafte Organisation und Digitalisierung
Für übergabewillige Inhaber sind digitale Angebote, strukturierte Abläufe und eine moderne Verwaltung keine Kür, sondern eine notwendige Voraussetzung für die Skalierbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit eines Betriebs. Denn Käufer wollen Unternehmen meist nur übernehmen, wenn sie gut integrierbar sind und Potenzial für weiteres Wachstum aufweisen. Betriebe ohne digitale Auftragsabwicklung, Zeiterfassung oder transparente Projektsteuerung gelten als schwer integrierbar – und verlieren so an Wert.
Fallstrick 3: Geringe Krisenfestigkeit
Die vergangenen Jahre waren von zahlreichen Krisen geprägt. So haben die Covid-Pandemie und der Einbruch des privaten Wohnungsbaus manches Unternehmen durchgeschüttelt oder gar in die Insolvenz getrieben. Dadurch ist deutlich geworden, wie wichtig ein robustes Geschäftsmodell für Unternehmen ist. Betriebe, die allen Herausforderungen zum Trotz wirtschaftlich stabil geblieben sind, gelten als resilient und vertrauenswürdig – ein klarer Vorteil im Verkaufsprozess.
Politische Rahmenbedingungen und Baukonjunktur als externe Unsicherheitsfaktoren
Bauunternehmer können zwar einiges tun, um die Attraktivität ihres Betriebs für potenzielle Käufer zu steigern – doch hängen Übergabechancen und Kaufpreise in vielen Fällen zusätzlich auch von externen Faktoren ab. Dabei spielt vor allem das politische Umfeld eine wichtige Rolle. Denn in den vergangenen Jahren fehlte es an vielen Stellen an verlässlichen Rahmenbedingungen. Diese sind aber gerade für Unternehmen im Bau- und Ausbaugewerbe aufgrund ihrer besonders starken Abhängigkeit von politischen Entscheidungen enorm wichtig. Die Ausgestaltung von Förderprogrammen, regulatorische Vorgaben, Fachkräftezuwanderung und Genehmigungsverfahren – all diese Faktoren beeinflussen die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen. Eine unklare Gesetzeslage – etwa rund um das Gebäudeenergiegesetz – und unvermittelte Änderungen bei Fördermitteln haben Investitionen erschwert und potenzielle Käufer abgeschreckt.
Besonders stark von äußeren Einflüssen abhängig zeigt sich der private Wohnungsbau, der lange Zeit eine tragende Säule vieler Handwerksbetriebe war. Durch gestiegene Zinsen, hohe Baukosten und verschärfte Auflagen ist die Nachfrage hier massiv eingebrochen. Viele Projekte werden aufgeschoben oder gänzlich gestrichen. Potenzielle Nachfolger oder Investoren sehen Betriebe mit starker Abhängigkeit vom privaten Neubau deshalb als risikobehaftet – insbesondere solche, denen ein zweites Standbein fehlt. Unternehmen, die auch für gewerbliche oder öffentliche Auftraggeber mit langfristig planbarem Investitionshorizont tätig sind, gelten als stabiler.
 Patrick Seip ist Partner und Managing Director der M&A-Beratung Syntra Corporate Finance. Er hat selbst eine Nachfolgeregelung im eigenen Haus verantwortet
Patrick Seip ist Partner und Managing Director der M&A-Beratung Syntra Corporate Finance. Er hat selbst eine Nachfolgeregelung im eigenen Haus verantwortet
Foto: Syntra Corporate Finance
Deutlich besser ist die Nachfrage bei Betrieben, die vom Umbau der Energieversorgung profitieren. Dazu gehören Photovoltaik-Installateure, Wärmepumpen-Experten und Betriebe für Gebäudetechnik. Wer in der energetischen Sanierung aktiv ist, profitiert grundsätzlich von staatlichen Programmen und einem großen Wachstumspotenzial. Allerdings hat die teils sprunghafte Förderpolitik der vergangenen Jahre – etwa beim Heizungsgesetz – auch hier für Verunsicherung bei den Investoren gesorgt. Attraktiv sind daher vor allem Betriebe, die in Segmenten tätig sind, in denen rechtliche und förderpolitische Rahmenbedingungen bereits klar und stabil geregelt sind. Das schafft Planungssicherheit – eine wichtige Voraussetzung für jede Nachfolge oder Investitionsentscheidung.
Zukunftstrends als Werttreiber – was Betriebe heute attraktiv macht
Ob ein Handwerksbetrieb einen geeigneten Käufer findet und einen guten Preis erzielt, hängt heute aber auch maßgeblich von der strategischen Ausrichtung des Unternehmens ab. Diese Themen liegen bei Kaufinteressenten aktuell besonders im Trend:
Modularisierung und Vorfertigung: Wer Arbeiten von der Baustelle in die Werkstatt verlagert – etwa durch vorgefertigte Installationsmodule – erhöht Effizienz und Marge. Solche Modelle sind skalierbar und daher interessant für Industrieunternehmen und andere strategische Investoren.
Fachkräftebindung als Geschäftsmodell: Der Fachkräftemangel trifft alle – doch einige Betriebe haben daraus eine Stärke gemacht: durch Ausbildung, moderne Arbeitszeitmodelle oder gezielte Rekrutierung gelingt es ihnen, ihr Team zu halten oder sogar auszubauen. Damit schaffen sie sich einen wichtigen Wettbewerbsvorteil.
Nachhaltigkeit und ESG-Kompetenz: Besonders im gewerblichen und öffentlichen Bereich achten Auftraggeber bei Ausschreibungen zunehmend darauf, dass die Betriebe umweltfreundlich und transparent wirtschaften und idealerweise zertifiziert sind. Nachhaltigkeit wird damit von einem Marketingargument zu einem Zugangskriterium für die Gewinnung profitabler Aufträge.
Der demografische Wandel trifft das Handwerk mit voller Wucht – und doch sind nicht alle Betriebe an externe Käufer vermittelbar. Entscheidend für eine erfolgreiche Nachfolge ist weniger die Größe des Betriebs als vielmehr dessen Struktur, Resilienz und Ausrichtung auf langfristige Trends. Wer schon heute auf Digitalisierung, Klimaschutz, Fachkräftebindung und klare Prozesse setzt, sichert sich nicht nur eine geregelte Nachfolge, sondern steigert auch den Wert seines Unternehmens spürbar.
Autor
Patrick Seip ist Partner und Managing Director der M&A-Beratung Syntra Corporate Finance. 2021 verantwortete er gemeinsam mit seinem Geschäftsführerkollegen Julian Will die Nachfolgeregelung im eigenen Haus.