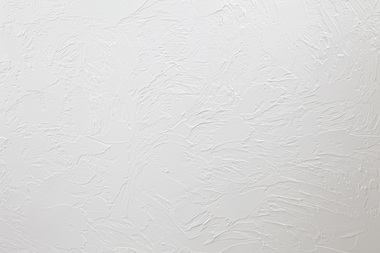bauhandwerk-Serie Lehm, Teil 3: Lehmputz
Im dritten Teil unserer Serie steht der Lehmputz im Fokus. Eine junge Familie erfüllte sich den Traum vom ökologischen Eigenheim – mit innovativer Haustechnik und natürlichen Baustoffen. Zur Ausführung kamen unter anderem Wandheizungsrohre auf Schilfstuckatur in Lehmputz.
 Bei der Haustechnik hat man sich für das Konzept des „Sonnenhauses“ entschieden, bei dem mehr als die Hälfte des Jahresenergiebedarfs für Heizung und Warmwasser von einer Solarthermieanlage gedeckt wird
Bei der Haustechnik hat man sich für das Konzept des „Sonnenhauses“ entschieden, bei dem mehr als die Hälfte des Jahresenergiebedarfs für Heizung und Warmwasser von einer Solarthermieanlage gedeckt wird
Foto: Industrieverband Lehmbaustoffe e.V.
Bei der Haustechnik entschied man sich für das Konzept des „Sonnenhauses“, bei dem mehr als die Hälfte des Jahresenergiebedarfs für Heizung und Warmwasser von einer Solarthermieanlage gedeckt wird. Der restliche Energiebedarf wird durch einen im Wohnraum integrierten Stückholz-Heizeinsatz gedeckt. Sowohl die etwa 18 m² große Solaranlage, die gleichzeitig als Brüstung für die Terrasse dient, als auch der Scheitholzofen speisen ihre Wärme in einen 3000 Liter fassenden Pufferspeicher, von wo aus sie dann wiederum über eine Flächenheizung an der Wand, die wir im zweiten Beitrag dieser Serie näher beleuchtet hatten, an die Räume abgegeben wird. Nur die wenigen gefliesten Räume werden über eine Fußbodenheizung versorgt.
Durch diese regenerative Energieerzeugung glänzt das KFW-Effizienzhaus 55 mit etwa 190 m² Wohnfläche mit einem äußerst niedrigen Primärenergiebedarf von nur 19 kWh/m²a. Die Materialwahl ist angesichts der Hanglage des Grundstücks hybrid: das Erdgeschoss besteht aus hoch wärmedämmenden Ziegeln, beziehungsweise im Erdreich aus Beton. Das Obergeschoss wurde in Holzbauweise ausgeführt. Die Dämmstoffe sind aus nachwachsenden Rohstoffen.
Warum Lehmputz?
Beim Innenputz war den Bauherren klar, dass es Lehm sein sollte. Lehmputze haben die Eigenschaft, sehr schnell sehr große Mengen Luftfeuchtigkeit aufzunehmen und zu speichern. Im Bedarfsfall wird die Feuchtigkeit schnell wieder abgegeben (Sorptionsfähigkeit). Dies sorgt für eine ganzjährig angenehme und relativ gleichmäßige Luftfeuchtigkeit im Raum. Außerdem reduziert Lehm Gerüche in der Raumluft. Zusammengenommen ergibt sich dadurch ein hervorragendes Raumklima. Zudem ergänzt der Lehm Flächenheizungen, weil er eine hohe Rohdichte von etwa 1800 kg/m³ hat, was für eine gute Wärmespeicherfähigkeit sorgt.
Lehm ist ein guter Wärmeleiter, so dass die Wärme der Wandheizungsrohre sehr schnell an den Raum weitergegeben wird. Außerdem hat sich Lehm bereits in der Verwendung beim Fachwerk mit seiner konservierenden Wirkung bewiesen. Lehm hält bei direktem Kontakt Holz trocken und kann es über Jahrhunderte schützen. Auch hat Lehmputz ästhetisch viel zu bieten: Rund 150 Farbtöne, mit und ohne Zugabe von Glitzer, Stroh oder anderen Zuschlagsstoffen sind bei den Herstellern erhältlich. Lehm wird durch Austrocknen fest und kann mit Hilfe von Wasser wieder aufgeweicht werden. Das heißt, im Falle eines künftigen Rückbaus kann der Lehmputz von der Wand geschlagen und eins zu eins bei der nächsten Baustelle wiederverwendet werden. Hersteller können der Internetseite des Industrieverbands Lehmbaustoffe entnommen werden.
Vorbereitung
Schilfstuckatur als Putzträger auf sägerauer Holzschalung
Foto: Industrieverband Lehmbaustoffe e.V.
Wie bei allen Putzmörteln muss der Untergrund trocken, fest und frei von losen Teilen sowie Schmutz sein. Lehmputz braucht darüber hinaus einen griffigen und am besten saugfähigen Untergrund. Gebrannte Ziegel bringen diese Eigenschaft von Haus aus mit, hier ist keine spezielle Vorbereitung nötig. Holzuntergründe – wie im Fall dieser Baustelle, eine Massivholzwand mit gehobelter Oberfläche oder Holzständerwände mit einer Schalung aus sägerauen Brettern – benötigen einen Putzträger. Neben Möglichkeiten wie Ziegelrabitzgewebe, Streckmetall oder Putzträgerplatten hat sich seit vielen Jahrhunderten die Schilfstuckatur bewährt. Bei dieser sind einzelne Schilfhalme mit verzinktem Draht miteinander verbunden. Die Schilfhalme haben dabei einen Abstand, liegen also nicht wie bei Sichtschutzmatten aus Schilf dicht an dicht. In der Regel werden hier etwa 70 Halme je Laufmeter verwendet. Die Schilfstuckatur wird in Rollen á 10 m² geliefert. Sie wird mit einem Druckluftklammergerät mit verzinkten Klammern an jeder Drahtreihe in einem Abstand von etwa 12 bis 15 cm am Holz angeklammert. Schilfstuckatur ist im Vergleich zu anderen Putzträgern günstig, nachhaltig und bietet den Vorteil, dass der nachfolgende Lehmputz direkt mit dem Holz in Kontakt kommt (Holzkonservierung).
Da auch kleinere Betonflächen mit Lehm verputzt werden sollten, wurde ein Kalkhaftputz mit einer Zahntraufel als Haftgrund aufgebracht. Alternativ wäre ein etwa 50 Prozent deckender Kalk-Zement-Vorspritzer möglich gewesen.
Mit Ansetzmörtel versetzte Kantenschutzleiste
Foto: Industrieverband Lehmbaustoffe e.V.
Auch bei Lehmputzen ist es sinnvoll und üblich, Kantenschutzleisten zu verwenden, um Außenecken vor späteren mechanischen Beschädigungen zu schützen. In der Regel werden hier verzinkte Leisten, wie zum Beispiel Drahtrichtwinkel verwendet, aber auch Kunststoffprodukte kommen zum Teil zum Einsatz. Manche Handwerker verzichten auf Kantenschutzleisten und formen die Kanten stattdessen rund. Zur Montage verwendet man auf Ziegel und Beton einen zementösen Ansetzmörtel, auf Holz erfolgt die Montage am schnellsten mit einem Druckluftklammerer. Bei dieser Baustelle wurde nach dem Aufbringen der Schilfstuckatur auch die Wandheizung auf etwa der Hälfte der Wandflächen montiert. Dazu wurden Zahnschienen aus Kunststoff auf den jeweiligen Untergrund geschraubt und die Wandheizungsrohre darin eingeclipst.
Verputzen
Lehmputzmörtel nach DIN 18 947 kann man nicht nur von Hand sondern auch mit gängigen Putzmaschinen wie der „PFT G4“ verarbeiten. Während man für erdfeuchte Lehmputzprodukte in der Regel eine etwas aufwändigere Maschine, bestehend aus Zwangsmischer und Förderpumpe benötigt, sind trockene Lehmputze meist mit handelsüblichen Durchlaufmischmaschinen verarbeitbar. Über geeignete Maschinentechnik kann der Hersteller des jeweiligen Lehmputzes Auskunft geben. Lehmputze sind verfügbar vor allem als Sack- und Big-Pack-Ware und regional auch in Silos.
 Hier wird der Lehmgrundputz mit der Putzmaschine auf die Ziegelwände aufgebracht
Hier wird der Lehmgrundputz mit der Putzmaschine auf die Ziegelwände aufgebracht
Foto: Industrieverband Lehmbaustoffe e.V.
Bei den Ziegelflächen wurde im ersten Schritt leicht vorgenässt und dann ein Vorspritzer aus sehr dünnflüssig angemachtem Lehmgrundputz aufgebracht. Bei den mit Schilfstuckatur vorbereiteten Flächen konnte darauf verzichtet werden. Als nächstes wurde die Hauptschicht des Lehmgrundputzes aufgespritzt – etwa 1,5 cm dick – und direkt mit der h-Profil-Kartätsche abgezogen. Bei den Holzflächen legten die Handwerkerinnen und Handwerker nach dem ersten Ansteifen des Putzes (nach wenigen Stunden) ein Putzgewebe aus Glasfaser auf und glätteten es mit dem Holzreibbrett in die Oberfläche ein. Die Flächen, die kein Gewebe benötigten, behandelten sie am nächsten Tag mit dem Gitterrabot, um die Oberfläche weiter zu begradigen.
Bei den Wandheizungsflächen wurde der Grundputz zuerst etwa auf Rohrdicke aufgespritzt. Nach dem Ansteifen wurde noch eine weitere Schicht bis etwa 5 mm über Rohrdicke aufgespritzt (gesamt etwa 3 cm) und anschließend ein Putzgewebe eingezogen.
 Wird zum Austrocknen der Grundputzschicht die Wandheizung eingeschaltet, zeichnen sich zuerst die Rohrbahnen hell an der Wand ab
Wird zum Austrocknen der Grundputzschicht die Wandheizung eingeschaltet, zeichnen sich zuerst die Rohrbahnen hell an der Wand ab
Foto: Industrieverband Lehmbaustoffe e.V.
Bevor als nächstes der Lehmfeinputz aufgetragen werden kann, muss der Grundputz vollständig ausgetrocknet sein. Dabei können leichte Schwundrisse auftreten. Diese Zwischentrocknung kann zwei bis drei Wochen dauern, da sämtliche in den Lehmputz eingebrachte Feuchtigkeit verdunsten muss. Um Bauschäden zu vermeiden, muss zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber unbedingt geklärt werden, wer für die Trocknungsphase verantwortlich ist und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen (zum Beispiel Fensterlüftung, oder das Aufstellen von Trocknungsgeräten). Es wird empfohlen, auch ein Trocknungsprotokoll zu führen. Wenn der Lehmputz an der Wand bis in die Ecken hinein dieselbe helle Farbe hat wie das Ausgangsmaterial, ist er trocken.
Der Lehmfeinputz ist ausgetrocknet und bereit für den nachfolgenden Anstrich
Foto: Industrieverband Lehmbaustoffe e.V.
Vor dem Auftragen des Lehmfeinputzes wurde die Oberfläche des trockenen Lehmgrundputzes nochmal leicht vorgenässt. Der Lehmfeinputz mit einer Körnung von 0,8 mm wurde mit der Putzmaschine angemacht und in Wannen ins Haus gefördert. Von dort aus brachten die Handwerker ihn dann mit Glättkellen in einer Auftragsdicke von etwa 3 mm an die Wand. Zur Begradigung filzten sie die Wand anschließend mit einem groben (orangen) Schwammbrett und stellten danach eine gleichmäßig körnige Oberfläche mit dem feinen (weißen) Schwammbrett her. Dann konnte der Lehmfeinputz trocknen, was aufgrund der geringen Schichtdicke nur wenige Tage dauerte.
Oberflächenbehandlung
Nach vollständiger Trocknung des Lehmfeinputzes kann die Oberflächenbehandlung erfolgen. Zuerst sollte die Oberfläche mit einem weichen Haushaltsbesen abgekehrt werden, um lose an der Oberfläche sitzenden Sand zu entfernen.
Beim vorgestellten Bauvorhaben entschieden sich die Bauherren einige Wände auf Sicht, sprich im originalen braunen Farbton zu belassen. Um die Oberfläche zu festigen und den Abrieb von Sand zu minimieren, besprühten sie deshalb die Wände zweimal mit einer diffusionsoffenen Lehmkaseingrundierung.
Die Wände, die farbig oder weiß werden sollten, wurden einmal mit derselben Grundierung behandelt, bevor sie zwei Anstriche mit einer Lehmkaseinfarbe bekamen. Lehmkaseinfarbe ist eine pulverförmige Farbe, die vor Verwendung mit Wasser angerührt wird. Die extrem diffusionsoffene Wandfarbe erhält ihre Farbgebung aus natürlichen weißen oder bunten Lehmen und Tonen. Um ein noch umfangreicheres Farbspektrum zu erzielen, kann man sie mit klassischen Erd- und Mineralpigmenten abtönen. Die Lehmfarbe kann mit der Bürste, Farbrollern oder auch mit Airless-Geräten aufgetragen werden. Den Bauherren war es wichtig, eine Farbe ohne künstliche Bindemittel oder Dispersionen wie Acryl zu verwenden, um die Wirkung des Lehmputzes für das Raumklima nicht zu reduzieren.
Fazit
Innenputze aus Lehm sind rationell und einfach auf verschiedensten Untergründen zu verarbeiten, ähnlich wie traditionelle Kalkputze, die in der Regel ebenfalls zweilagig aufgebaut werden (etwas dickerer Grundputz und dünner Feinputz). Der neutrale pH-Wert und die einfache Reinigung von Werkzeug und Maschinen freut die Handwerkerinnen und Handwerker. Die Bauherren dagegen sind von den positiven Auswirkungen auf das Raumklima, der angenehmen Haptik und der vielen gestalterischen Möglichkeiten begeistert. Und der niedrige Primärenergiebedarf bei der Herstellung sowie die mögliche Wiederverwendung nach dem Abriss machen Lehmputz zu einem zukunftsfähigen Baustoff.
Im zweiten Teil unserer Lehm-Serie ging es in bauhandwerk 9.2025 um den Trockenbau mit Heiz- und Kühlplatten aus Lehm. In der kommenden Ausgabe der bauhandwerk 11.2025 setzen wir unsere Serie mit dem ersten Teil zu Wandbaustoffen aus Lehm fort.
AutorinDr. Ipek Ölcüm ist Rechtsanwältin und Geschäftsführerin des Industrieverbands Lehmbaustoffe e.V. in Berlin.